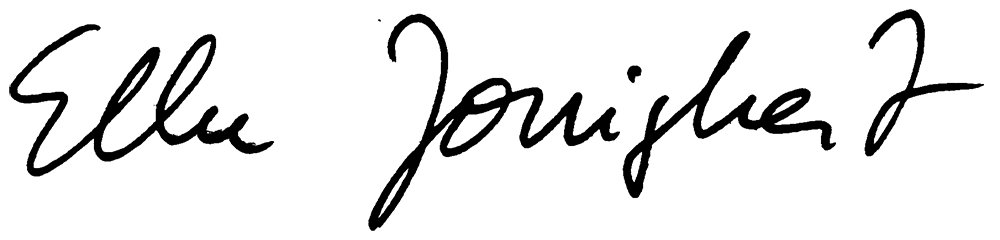Überleben in Kabul
Eine Stadt und ihre Frauen - 2010
Seit 25 Jahren kehre ich immer wieder nach Kabul zurück.
Eine widersprüchliche Faszination übt diese Stadt und ihre Menschen auf mich aus.
Die Jahre vergehen, Kriege überziehen das Land mit unsäglichem Leid - und doch schlägt das Herz Kabuls immer noch im alten Rhythmus.
Die Straße gehört den Männern.
Alt und Jung drängt sich durch die engen Gassen der Altstadt, in denen wie eh und je jegliche Ware verkauf und jedes Handwerk ausgeübt wird.
Frauen sieht man hier nicht. Wenn doch einmal - dann tief verschleiert - so als hätte es das viele Hin und Her der letzten 30 Jahre gar nicht gegeben.
Und gerade hier lernte ich Frauen kennen, deren Geduld, Klugheit, Schönheit und Herzlichkeit mich bis heute wärmen.
Zitate der Protagonistinnen
Kabul - Metropole für Glücksritter im Wilden Osten
Frankfurt – Kabul, täglich non stop. Mein langjähriger Mitarbeiter Nurullah und ich fliegen mit Safi Airways, einer im Sommer neu gegründeten privaten afghanischen Fluglinie. Nach 6 Stunden landen wir in Kabul.
Der Terminal „Kabul International“ ist neu, die Ankunftshalle hell erleuchtet, das Kofferband spuckt die Gepäckstücke zügig aus. Fast bin ich enttäuscht: nichts Exotisches ist mehr zu sehen – der Flughafen Kabul ist wie jeder andere im Westen.
Allerdings werde ich beim Verlassen der modernen Ankunftshalle sofort mit der neuen afghanischen Wirklichkeit konfrontiert: Der Platz vor dem Flughafen – früher immer voller geschäftiger Männer – ist vollkommen leer. Nur ein Bus wartet auf die Fluggäste aus aller Welt. Wir wuchten unser Gepäck hinein und fahren über den leeren Platz, dann über einen zweiten und halten schließlich auf einem dritten. Hier werden nochmals unsere Pässe und Visa überprüft. Aus Sicherheitsgründen darf kein Auto bis zum Flughafengebäude vorfahren, auch zu Fuß darf sich ihm kein Unbefugter nähern. Dschawed, Nurullahs Bruder, hat uns entdeckt und kommt auf uns zu: „Herzlich willkommen in Kabul“, sagt er, umarmt Nurullah und begrüßt mich, eine Frau, indem er seine rechte Hand auf sein Herz legt. Wir fahren los.
Auf sechsspurigen, autobahnähnlichen Straßen, die in alle Himmelsrichtungen führen, drängeln sich japanische Pkw’s, riesige Jeeps mit undurchsichtigen, schusssicheren Scheiben, grüne Pic-ups der afghanischen Polizei und tarnfarbene Militärfahrzeuge aller Art.
Dschawed schaut mich an und flüstert Nurullah verlegen etwas zu. Dieser übersetzt: „Es ist ihm peinlich, aber er möchte Dich bitten, den Tschador möglichst tief ins Gesicht zu ziehen. Je weniger wir auffallen, desto besser“. Ich merke schnell, dass dies sinnvoll ist. An jeder Ecke, jeder Kreuzung – eigentlich überall – stehen bewaffnete Polizisten und winken immer wieder Fahrzeuge hinaus, um sie zu kontrollieren. Wollen wir ohne Zeitverzögerungen durch die Stadt fahren, soll man nicht erkennen, dass eine Ausländerin im Auto sitzt.
Jawed weist uns auf die riesigen Strommasten neben der Straße hin und sagt stolz: „Der Strom kommt aus Tadschikistan - über schroffe, zerklüftete 4000 Meter hohe Berge hinweg und durch sie hindurch. Natürlich reicht es immer noch nicht für alle Haushalte und viele sind auch noch zu arm, um sich Strom überhaupt leisten zu können.“
Modernste Tankstellen warten auf Kunden – die jedoch stehen lieber stundenlang Schlange an vorsintflutlich anmutenden staatlichen Zapfstellen, weil man dort einige Afghanis pro Liter Benzin oder Diesel spart.
In diesem Moment kommen wir an einer Zeltsiedlung vorbei. Hier wohnen die Armen der Ärmsten – oft sind es Rückkehrer aus Pakistan oder dem Iran, die nicht in ihre Dörfer zurück können, weil dort wieder gekämpft wird und die Miete für eine Stadtwohnung für sie unbezahlbar ist.
Kabul ist von ehemals 300.000 zur Talibanzeit auf heute 6 Millionen Einwohner angewachsen.
Auch wenn in der westlichen Welt die Grundstückspreise fallen, in Kabul steigen sie rasant.
Ganze Stadtviertel wurden neu gebaut, Straßenzüge, wo seinerzeit nur Ruinen oder Schutthaufen zu sehen waren, sind neu entstanden. Glasverspiegelte Bankgebäude, glitzernde Weddinghalls, in denen allabendlich teure Hochzeiten stattfinden, und modernste Kaufhäuser wurden aus dem Boden gestampft.
Später besuchen wir ein solches Kaufhaus: Der Eingang ist pompös mit einem roten Teppich ausgelegt, im Inneren werden die Waren in verspiegelten Glasvitrinen angeboten. Es sind Luxusartikel aller Art: teure französische Parfüms, Goldschmuck, Designerhandtaschen und vieles mehr. Blonde, amerikanisch anmutende Schaufensterpuppen präsentieren hier tief ausgeschnittene Abendkleider, Schuhe mit Pfennigabsätze und sogar Reizunterwäsche – dazwischen tummeln sich tief verschleierte Frauen.
All diese neuen Gebäude und Straßen haben sich hineingefressen in die traditionellen, quirrligen Basare mit ihren kleine Büdchen und mobilen Handkarren, die wie eh und je durch die Straßen gezogen werden, um Obst, Gebrauchsartikel aller Art oder Kleidung zu verkaufen. In Kabul verschwindet alles Sichtbare in einer riesigen, nur schwer erträglichen Staubwolke. Die Menschen leiden an Atemnot und schlechter Haut. Das Grün der neu angepflanzten Bäume, die Farben der Blumen, die bunte Kleidung der Menschen - alles versinkt im Einheits-Grau des dichten Smogs.
Dort, wo sich besonders viele Männer durch engen Gassen quetschen, Jungen auf den niedrigen Dächern Drachen steigen lassen und Handwerker ihre Waren herstellen, als lebten sie im Mittelalter – dort sind die Spuren der seit 30 Jahren andauernden kriegerischen Handlungen deutlich zu sehen: notdürftig reparierte Lehmhäuser, Schuttberge, Trampelpfade. Hier gibt es keine Verkaufspaläste. Wir sind im Herzen Kabuls, in der Altstadt. Noch hat die afghanische Regierung nicht entschieden, ob man die Reste der Vergangenheit abreißt oder sie traditionsbewusst wieder aufbaut.
Wir fahren ins Stadtviertel Makrojan, um die Schule zu besuchen, in der ich 2002 Filmaufnahmen machte. Noch vor zwei Jahren waren auf dem Schulgelände neben den beiden Hauptgebäuden 6 große Zelte aufgeschlagen. An ihrer Stelle stehen heute 6 neue Pavillions. In dieser Schule werden täglich 6500 Schülerinnen in drei Schichten unterrichtet. Der Schulhof ist überfüllt von schwatzenden und lachenden Mädchen. Sie fragen mich „Where are you from“ und lachen, als ich auf Englisch antworte. Es entspinnt sich ein kurzes Gespräch, in dem sie mir erzählen, wie gern sie hier zur Schule gehen, wie gut sie sich mit den Lehrerinnen verstehen und wie stolz sie sind, Englisch zu lernen.
Niemand in Afghanistan hält heute die Bildung noch für unwichtig – egal ob für Jungen oder Mädchen. Überall werden Schulgebäude gebaut. Die größte staatliche Jungenschule hat mehr als 10.000 Schüler. Daneben gibt es unzählige Privatschulen und Privatuniversitäten. Woher soll ein Afghanistan, in dem es bis vor 8 Jahren Schulbildung nur für Jungen aus der besseren Schicht gab, die notwendigen Lehrer nehmen.
Wenn keine professionell ausgebildeten Lehrer mehr gefunden werden können, stellt man kurzerhand Hilfskräfte ein, die selbst schlecht oder gar nicht ausgebildet wurden. Um die besseren reißen sich die Privatschulen – Eliteschulen für die Neureichen, die über wesentlich mehr Geld verfügen. Zum Vergleich: ein Lehrer an einer staatlichen Schule verdient momentan rund 70 € pro Monat, an einer Privatschule kommt er gut und gern auf das 10 bis 20 fache. Ausländische Fachkräfte werden noch viel besser bezahlt.
Uns unser nächstes Ziel ist das Frauengefängnis: Ein modernes Gebäude steht nun an der Stelle des alten, düsteren Lehmbaus, in dem ich 2002 Filmaufnahmen machte. Damals saßen die in ihre Schleier eingehüllten Frauen schüchtern in einer Ecke ihrer Zelle, und ich musste viel Geduld aufbringen, ihnen für einen kurzen Moment in die Augen sehen zu können. Im Gefängnis von heute herrscht reges Leben. Dort kommen die Gefangenen in den Genuss des offenen Strafvollzugs. Tagsüber sind die Zellentüren offen und die Frauen können sich besuchen oder an Weiterbildungskursen teilnehmen. Wie 2002 leben die Kinder bis zum Alter von 9 Jahren mit ihrer Mutter in der Gefängniszelle, sind also ebenfalls eingesperrt. Früher gab es keinerlei Beschäftigung, weder für die Mütter, noch für die Kinder - auch keinen Schulunterricht. Nun gibt es für die ganz Kleinen einen Kindergarten und für die größeren Vorschul-, bzw. Schulgruppen.
Heute wird für alle in einer Gefängnisküche gekocht und diejenigen, die allein sind und draußen keine Angehörigen mehr haben, werden nicht auch noch mit Hunger bestraft. Denn früher musste die Familie ihre Gefangenen selbst versorgen und für sie das Essen ins Gefängnis bringen. Wer keine Angehörigen hatte ging leer aus und war bereit, für ein Stück Brot jeden Sklavendienst zu tun.
Um das Gefängnis besuchen zu dürfen, mussten wir im Ministerium für Rechtswesen eine Erlaubnis einholen. Vor jedem größerem Gebäude, egal ob es sich um eine Bank, ein Kauf - oder Krankenhaus, eine Schule oder ein Ministerium handelt, kontrollieren bewaffnete Sicherheitskräfte am Eingang jede Person. Leibesvisitationen und Durchsuchungen, vergleichbar mit denen am Flughafen, müssen wir jedes Mal über uns ergehen lassen. Dabei wird zum Teil modernste Technik eingesetzt: Beim Betreten des Ministeriums werden wir nach den üblichen Kontrollen noch fotografiert und bekommen einen kleinen Zettel mit unseren Namen und einem Strichcode. Beim Erreichen des Vorzimmers des Ministers wird der Strichcode eingelesen und das Foto erscheint auf dem Bildschirm. Wir werden eingelassen.
Dschawed hat mich im „Guest House Europa“ untergebracht, das innerhalb der Innenstadt liegt. Überall stößt man dort auf Straßensperren und Kontrollen. Um den Kern der Stadt mit den Gebäuden der internationalen Botschaften, Konzerne, Institutionen, der afghanischen Regierung und der ausländischen Hilfsorganisationen, wie UNAID, World-Food-Programm, Rotes Kreuz, Roter Halbmond etc. wurde ein hermetisch abgeschlossener Sicherheitsring gezogen. Die hinein- und hinausfahrenden Autos werden von bewaffneten afghanischen Polizisten streng kontrolliert. Die meisten Straßen sind hier nochmals durch Sandsäcke, hohe Betonmauern und rot-weiße Doppelschranken gesichert. Oftmals kann man ohne Sondergenehmigung gar nicht durchfahren oder -gehen. Vor jedem öffentlichen Gebäude türmen sich Betonschleusen - oft liebevoll bepflanzt mit blühenden Rosen oder Geranien.
Kaum habe ich mich an die vielen Betonmauern, die immer höher in den Himmel wachsen und deren brutale Hässlichkeit zum Teil durch noch hässlichere graue Stoffplanen kaschiert werden soll, gewöhnt wie an die ständigen Kontrollen und Absperrungen, da sprengt sich zur Frühstückszeit in unmittelbarer Nähe meines Gästehauses ein Selbstmordattentäter in der indischen Botschaft in die Luft. 13 Tote, viele Verletzte. Keiner der Gäste oder Mitarbeiter gerät in Panik. Einige Tage Kabul haben genügt, um all das Außergewöhnliche für normal zu halten. Ich fühle mich weder unsicher, noch habe ich Angst vor einem Attentat oder Überfall, auch nicht vor einer Entführung und schon gar nicht, dass mich einer der ständig präsenten Polizisten mit seiner MP erschießen könnte.
Vom Innenhof meines Gästehauses aus kann ich die Sendemasten und -schüsseln verschiedener Fernsehsender sehen. Momentan gibt es einen öffentlich rechtlichen und 18 private TV-Sender. Die privaten Rundfunksender schießen wie Pilze aus dem Boden - es sollen hunderte sein. Jeder Provinzfürst oder Dorfvorsteher, der es sich leisten kann, geht auf Sendung.
Jeden Abend habe ich die Wahl zwischen unzähligen afghanischen und ausländischen Fernsehsendern. Ich kann religiöse, ja fundamentalistische Programme, indische Spielfilme, Nachrichten oder Softpornos einschalten. Gesendet wird auf Dari (Afghanisch), auf Arabisch, Urdu, Chinesisch, Russisch, Englisch und in einigen indischen Sprachen.
Ich stelle mir vor, wie solche Fernsehprogramme auf die in ihren konservativen Wertevorstellungen gefangenen „normalen“ Menschen wirken. Auch wenn sich noch nicht jede Familie in Kabul einen Fernseher leisten kann, so haben die Männer doch Gelegenheiten genug, in den Teestuben, Kebabbüdchen oder Restaurants Bollywood Filme mit halbnackten Bauchtanztänzerinnen zu genießen. Und dann kehren sie heim zu ihren Frauen, von denen sie verlangen, nur verschleiert und in Begleitung eines männlichen Familienmitgliedes auf die Straße zu gehen.
Am Wochenende fahren wir nach Karga vor den Toren Kabuls. 2002 filmte ich dort, wie britische Soldaten in der zerschossenen Ruine einige Talibankämpfer entwaffneten. Heute hat sich Karga zu einem beliebten Ausflugsort für betuchte Männer entwickelt. Sie fahren Bötchen auf dem Stausee und lassen sich auf luftigen Terrassen lukullisch verwöhnen. Einige der Männer spielen auf neu angelegten Rasenflächen Golf oder genießen die grandiose Aussicht des Golfhotels.
Frauen sehe ich hier nicht, auch keine Familie mit ihren Kindern. Ich als Ausländerin rufe zwar Erstaunen hervor – aber mehr deswegen, weil fast alle Ausländer aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben. Auch die Straßen innerhalb Kabuls meiden sie – nach außerhalb zu fahren, wagt so gut wie niemand.
Hier wird investiert, was das Zeug hält. Aber den Boom schaffen nicht öffentliche Gelder der afghanischen Regierung sondern Privatinvestoren – Drogenbarone, ausländische Geschäftsleute, einflussreiche Warlords, wohlhabende Auslandsafghanen. Sie alle verfolgen mit ihren Geldern ihre eigenen Privatinteressen. Nur im seltensten Fall denken sie dabei ans Allgemeinwohl.
Diese Investoren sind überhaupt nicht daran interessiert, ein modernes, starkes, demokratisches Afghanistan aufzubauen, in dem ein funktionierendes Finanzsystem dem Staat Steuereinnahmen bescheren und damit seinen Handlungsspielraum erhöhen würde. Im Augenblick zahlt kaum einer Steuern.
So sind diese Investoren vor allem daran interessiert, dass der afghanische Staat weiterhin schwach bleibt und auf Hilfsgelder der Geberländer angewiesen ist. Am besten soll es so bleiben, wie es etabliert wurde: Jedes Geberland, egal ob Deutschland, die USA, Frankreich oder Japan, soll weiterhin bestimmen können, wie seine Hilfsgelder ausgegeben werden – eine Koordination mit der afghanischen Regierung ist nicht vorgesehen und auch gar nicht erwünscht. So baute z.B. die Deutsche Welle im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland für 16 Millionen Euros ein hochmodernes Fernseh- und Rundfunkstudio, das jedoch nie auf Sendung ging, weil man „vergessen hatte“, sich mit der afghanischen Regierung über Inhalte zu einigen. Bis heute blieb es ungenutzt, wird aber auch nicht der öffentlich-rechtlichen afghanischen Fernsehanstalt zur selbständigen Nutzung überlassen.
Solange der afghanische Staat von den Geberländern abhängig bleibt, desto besser können diese ihre eigenen wirtschaftlichen, ideologischen und politischen Interessen durchsetzen.
- OriginaltitelÜberleben in Kabul -
Eine Stadt und ihre Frauen - RegieElke Jonigkeit
- KameraElke Jonigkeit, Munir Rasuli
- SchnittElke Jonigkeit
- MusikHenning Christiansen
- Ton und TongestaltungCornelius Kaminski
- HauptmischungMichael Brod
- FarbmischungDorothee Sechelmann
- GrafikMathias Peinelt
- SprecherinGergana Muskalla
- MitarbeitJawed Nury
- AufnahmeleitungNurullah Ebrahimy Cornelius Kaminski
- Dramaturgische BeratungSimone Jung
- ProduktionsleitungHartmut Kaminski (circe-film) Katrin Klöntrup (hr)
- RedaktionSabine Mieder
- ProduktionEine Koproduktion der CIRCE-FILM-GmbH und des Hessischen Rundfunks
- Erscheinungsjahr2010
- vielen Dank anNAZO Professional Education Center; KABUL Parwin Dost; Mina Sediqi; Tajwar Kaker; Hafiza Haschemi;
Sodaba und Thamina; Samir; Zohra; Tamana; Thamina; Saida; Madina; Navida; Sakina
Schülerinnen der Abdul Qasem Feroqusi High School; Mohamad Hasem; General Amir Mohamad Dschamsched; Sarafschon: Nages Maretsch